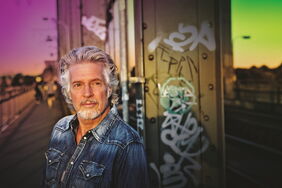Picture-Alliance/dpa
Es kommt nicht oft vor, dass sich das Nordlicht so weit im Süden zeigt wie über diesem Windpark in Ostfriesland 2024. Mindestens ebenso rar erscheinen gute Nachrichten über die Energiewende. Dabei kommt der Ausbau sauberer Energien erstaunlich schnell voran.
Von Volker Kühn
Die Gesellschaft ist gespalten, das Vertrauen in die Regierung erschüttert, andere Länder ziehen technologisch davon: Das könnte eine Beschreibung der Bundesrepublik nach dem Ampelbruch sein. Gemeint aber sind die USA der frühen Sechziger. Das Land durchlebt damals eine Phase tiefer Verunsicherung. Die Invasion in der Schweinebucht auf Kuba gerät zum Fiasko für die junge Kennedy-Regierung und in der Heimat liefern sich Bürgerrechtler Kämpfe mit dem Ku-Klux-Klan. Auch der prestigeträchtige Wettlauf ins All scheint verloren, seit der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin lächelnd von seiner Erdumrundung zurückgekehrt ist.
In dieser Lage hält John F. Kennedy 1962 eine bemerkenswerte Rede. Noch vor Ende des Jahrzehnts, so erklärt der Präsident vor 35.000 Menschen in Houston, werde Amerika zum Mond fliegen – und zwar „nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist“. Das Unterfangen werde Unsummen kosten und man wisse nicht, was es zu gewinnen gebe, räumt er ein. Doch Skeptikern hält er Amerikas Urtugend entgegen: unerschütterlichen Optimismus. Der Mondflug sei „ein Akt des Glaubens und der Vision“, erklärt er. Sieben Jahre später hält die Welt den Atem an, als Neil Armstrong „ein großer Sprung für die Menschheit“ gelingt.
Klimakrise und Kriege: Gründe zum Verzweifeln gäbe es genug
Kennedys Rede ist fast 63 Jahre alt, doch sie liest sich wie ein Rezept gegen jenen Mix aus Trübsal und Verdruss, der Deutschland erfasst hat. Kaum ein Tag vergeht ohne schlechte Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Industrie-Ikonen taumeln, Mittelständler drohen mit Exodus, die 1,5-Grad-Grenze ist gerissen und Klimagipfel enden im Minimalkompromiss. Während Tier- und Pflanzenarten in nie gekanntem Tempo aussterben und Wetterextreme um den Globus jagen, wirken Klimaaktivisten seltsam erschlafft. Während Dürren und Fluten Menschen in aller Welt zur Flucht zwingen, planen die USA offenbar den erneuten Ausstieg aus dem Klimaabkommen.
Die Lage ist ernst, keine Frage. Doch sie ist bei Weitem nicht immer so schlecht wie behauptet. Und die vielstimmigen Untergangsgesänge werden mehr und mehr zum Problem. Wer engagiert sich noch, wenn er laufend hört, dass alles den Bach runtergeht, wer motiviert andere, im Kampf gegen die Klimakrise den Mut nicht sinken zu lassen?
Menschen blenden das Gute aus – und überschätzen das Schlechte
„Die Gefahr ist, dass man sich von einer Flut schlechter Nachrichten so stark beeinflussen lässt, dass man in einen Zustand von Hoffnungslosigkeit und Passivität verfällt“, sagt Eva Asselmann, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Dummerweise reagieren Menschen auf Negatives besonders stark. Schlechte Nachrichten bleiben besser im Gedächtnis, gute werden ausgeblendet oder unterschätzt.
Dahinter steht ein Mechanismus, den Psychologen Negativitätsverzerrung nennen. Evolutionär war er durchaus berechtigt, sagt Asselmann: Wer überall Unheil witterte, hatte bessere Chancen, dem sprichwörtlichen Säbelzahntiger zu entgehen.
Doch angesichts der sich beschleunigenden Klimakrise ist der Mechanismus fatal. Denn mit Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit werden wir den Planeten nicht retten. Es braucht dazu ein Mindestmast an Mut und Zuversicht, sagt die Forschung.