
Picture-Alliance/Robin Utrecht
Von Windrädern umstellt: Atomkraftwerk Borssele in den Niederlanden.
Von Kathinka Burkhardt
Das Gerücht von einer „Renaissance der Atomenergie“ hält sich hartnäckig, doch die Realität rund um den Globus sieht anders aus. In Deutschland ist die Atomkraft seit April Geschichte, und auch wenn viele andere Länder weiter daran festhalten, spielt sie nirgendwo die Hauptrolle beim Umstieg von fossilen auf CO2-freie oder -arme Technologien. Während der Ausbau der Wind- und Solarenergie boomt, sinkt der Anteil der Atomenergie an der weltweiten Stromversorgung seit Jahren. Ein Überblick über die Lage in Europa, den USA und China.




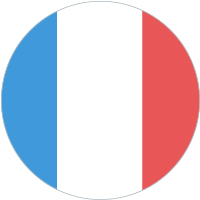
 Großbritannien
Großbritannien Niederlande
Niederlande
 Finnland
Finnland
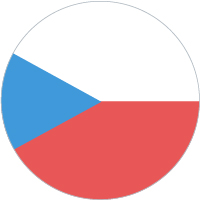 Tschechien
Tschechien Slowakei
Slowakei Ungarn
Ungarn Türkei
Türkei China
China USA
USA Russland
Russland


