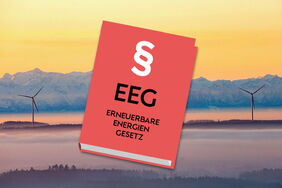Picture-Alliance/Flashpic
Nina Scheer setzt sich für mehr Gerechtigkeit in der Energiewende ein. Den milliardenteuren Netzausbau sieht sie als Aufgabe des Staates, nicht der Stromkunden.
Frau Scheer, Sie sagten einmal, es sei eine zentrale Menschheitsaufgabe, den Umstieg auf erneuerbare Energien so schnell wie möglich zu schaffen. Warum?
Nina Scheer: Weil es für Volkswirtschaften und die gesamte Menschheit gravierende Folgen hat, von fossilen Energieressourcen weiter abhängig zu sein. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, der schon Grund genug wäre, die Energiewende zu schaffen. Wir sehen Kriege um Ressourcen – ich erinnere an die Golfkriege. Dieses Ringen um Vormachtstellungen wird auch beim jüngsten Zolldeal zwischen Donald Trump und Ursula von der Leyen erkennbar: Europa soll sich verpflichten, aus den USA fossile Rohstoffe im Volumen von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Je mehr sich Abhängigkeiten verfestigen und Verknappung zuspitzt, desto gefährlicher werden auch Aufrüstungsspiralen und desto mehr geraten demokratische Strukturen unter Druck. Reichtum – auch aus Ressourcenhandel, in den Händen von Oligarchen – kann sich dann auch als weltumspannender Faschismus Bahn brechen. Und warum hat Donald Trump wohl Interesse an Grönland?
Was meinen Sie?
Scheer: Wegen der Ressourcen, die dort lagern. Festzuhalten ist: Fossile Energieressourcen binden CO2, das nicht weiter in die Atmosphäre gelangen darf. Entscheidend wird sein, auf welchem Weg dies erreichbar ist. Setzen wir an den Folgewirkungen an, dem CO2-Ausstoß, oder bereits am Anfang der Verursachungskette? Das ist meines Erachtens die entscheidende Frage. Wir sollten den Vorteil der Erneuerbaren nicht allein darauf reduzieren, dass sie den CO2-Ausstoß mindern.
Wie meinen Sie das?
Scheer: Ein alleiniger Fokus auf CO2 und übrigens auch auf die Atomenergie suggeriert, man könne den Klimawandel in den Griff bekommen, indem man CO2 aus der Atmosphäre entnimmt, ohne aber auch eine Abkehr von der Nutzung fossiler Ressourcen erreichen zu müssen. Der Fokus auf CO2 nutzt dabei interessanterweise eben jenen, die CO2 emittieren, da entsprechende Klimaschutzpolitiken anhand des Emissionshandels in erster Linie auf einen Umgang mit CO2 zielen, statt die Emissionen zu unterbinden. Damit bleibt die fossile Ressourcennutzung „mit am Tisch“.
Und gestaltet die Zukunft mit?
Scheer: Genau. Zwar wird auch die Vermeidung belohnt; Vermeidung ist aber beim Fokus auf CO2 nicht zwingend, solange aus wettbewerblichen Gründen nur ausreichend Dispens verlangt wird. Dies spiegelt auch die aktuelle Debatte erneut wider: Sobald der Emissionshandel „spürbar“ wird, werden Hilfen, werden weitere kostenlose Zertifkatezuteilungen, wird zeitlicher Aufschub verlangt. Gilt der Umgang mit CO2 einmal auch rechtlich betrachtet als Klimaschutz – und dies ist beim CO2-Handel der Fall –, ist es nur noch ein kleiner Schritt, diesen Umgang im Sinne von Klimaschutz auch staatlich zu fördern –, weil Klimaschutz ja nun mal eine Menschheitsaufgabe ist. Eine solche Förderung schafft aber unweigerlich eine ökonomische Konkurrenz zur echten Vermeidung von CO2 und damit auch eine Konkurrenz zu Erneuerbaren Energien. Diese politisch entstehende Konkurrenz wird viel zu wenig thematisiert. Zwar kennen die meisten den Begriff „klimaschädliche Subventionen“.
Wenn es aber dann etwa darum geht, CCU – Carbon Capture and Utilization, also die Abscheidung und Nutzung von CO2 – und CCS – Carbon Capture and Storage, die Abscheidung und Speicherung von CO2 – als Beitrag zum Klimaschutz zu fördern, würden die wenigsten diesen Begriff im Kopf haben. Und bei der Frage nach generellen Energiesubventionen würden wohl die meisten an die Förderungen der Erneuerbaren denken. Dabei sind all die klimaschädlichen Subventionen, auch solche, die in Bezug auf CCU oder CCS eingesetzt würden, ebenfalls Energiesubventionen – mit dem einzigen Unterschied, dass sie an einem anderen Glied in der Wertschöpfungskette ansetzen. Der Fokus auf CO2 als Instrument des Klimaschutzes kann nur dann auch marktlich in Bezug auf die gesamte Wertschöpfungskette funktionieren, wenn es keinerlei Förderung von Technologien im Umgang mit CO2-Emissionsentstehung und dem Umgang mit CO2 gibt. Mit Förderung, egal an welcher Stufe der Wertschöpfung man ansetzt, hat es immer einen marktverzerrenden Effekt gegenüber den Vermeidungsalternativen, den erneuerbaren Energien.
Dieser Effekt wirkt verharmlosend mit Blick auf die weiteren Folgewirkungen fossiler Ressourcen: Emittenten können zu Akteuren des Klimaschutzes werden, während sie weiter fossile Ressourcen im Energiesystem halten – Atomenergie eingeschlossen. Deswegen ist es so wichtig, beim Klimaschutz keine Verengung auf CO₂ vorzunehmen.




 Nina Scheer, Jahrgang 1971, ist seit 2013 Abgeordnete im Bundestag und Energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Seit 2011 gehört sie der SPD-Grundwertekommission an. Sie hat abgeschlossene Studien in Musik (mit dem Hauptfach Violine) und Jura sowie in Politikwissenschaft promoviert. Vor Mandatsantritt arbeitete sie zuletzt mehrere Jahre als Geschäftsführerin von UnternehmensGrün eV. und hatte verschiedene Lehraufträge. 2018 initiierte Nina Scheer den
Nina Scheer, Jahrgang 1971, ist seit 2013 Abgeordnete im Bundestag und Energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Seit 2011 gehört sie der SPD-Grundwertekommission an. Sie hat abgeschlossene Studien in Musik (mit dem Hauptfach Violine) und Jura sowie in Politikwissenschaft promoviert. Vor Mandatsantritt arbeitete sie zuletzt mehrere Jahre als Geschäftsführerin von UnternehmensGrün eV. und hatte verschiedene Lehraufträge. 2018 initiierte Nina Scheer den