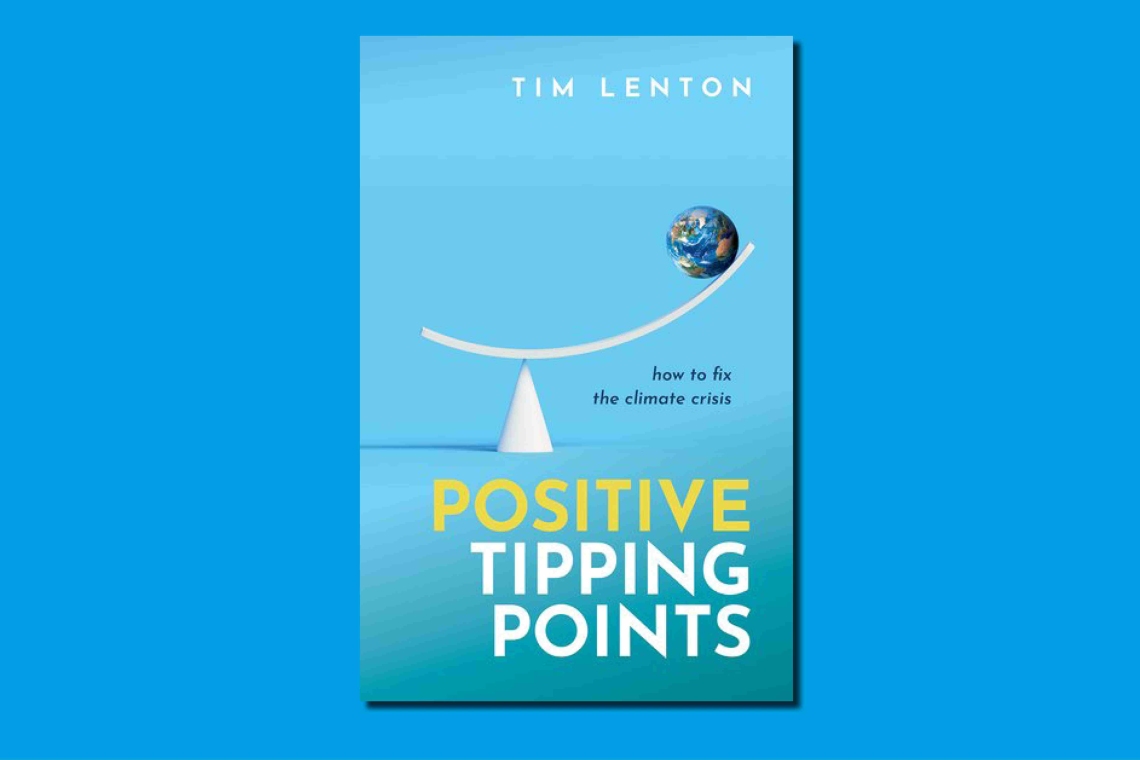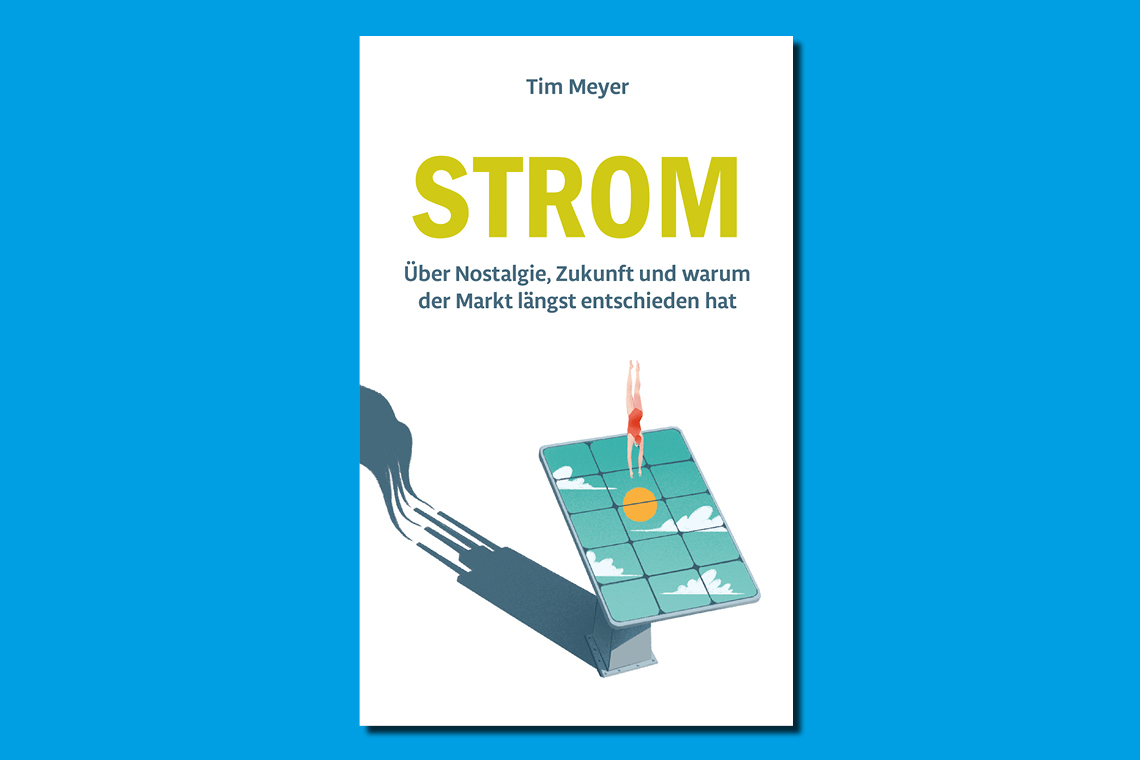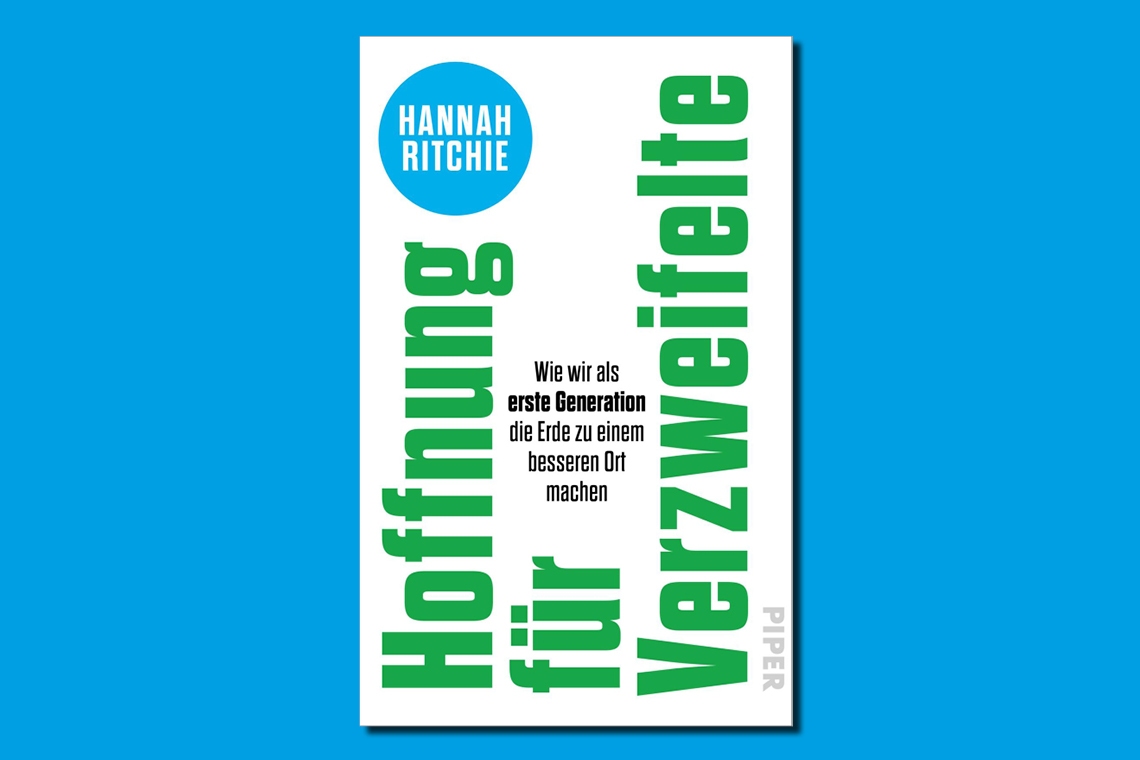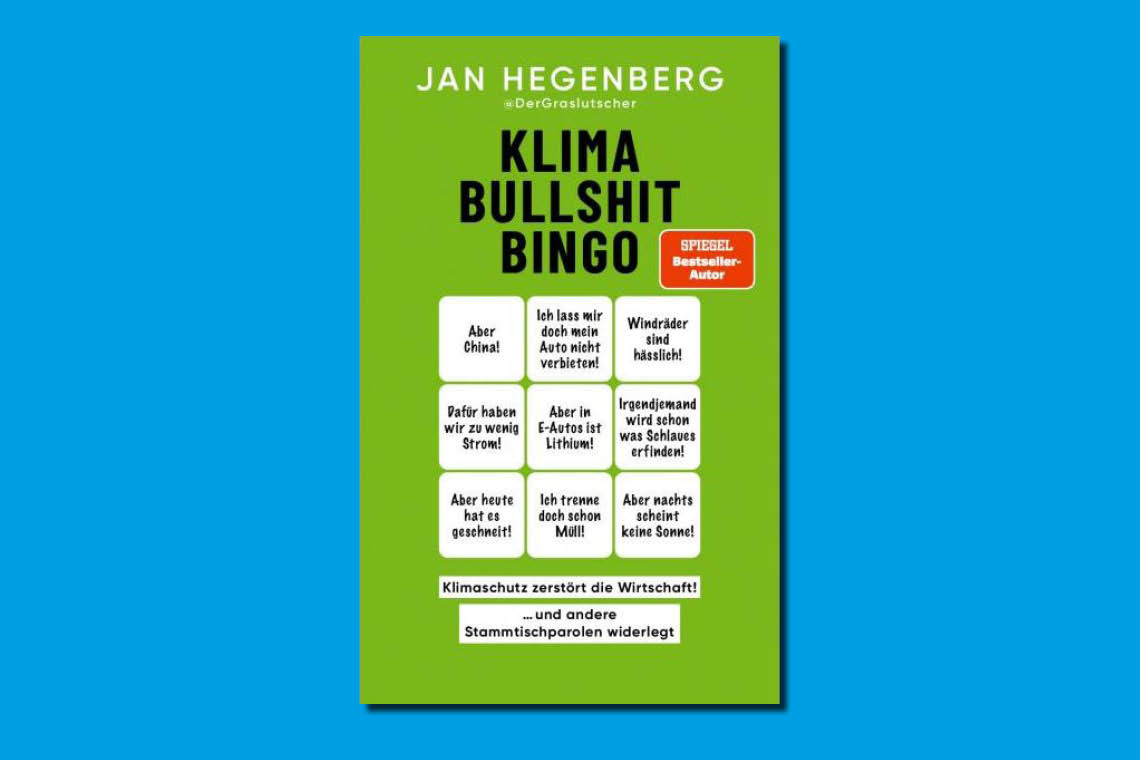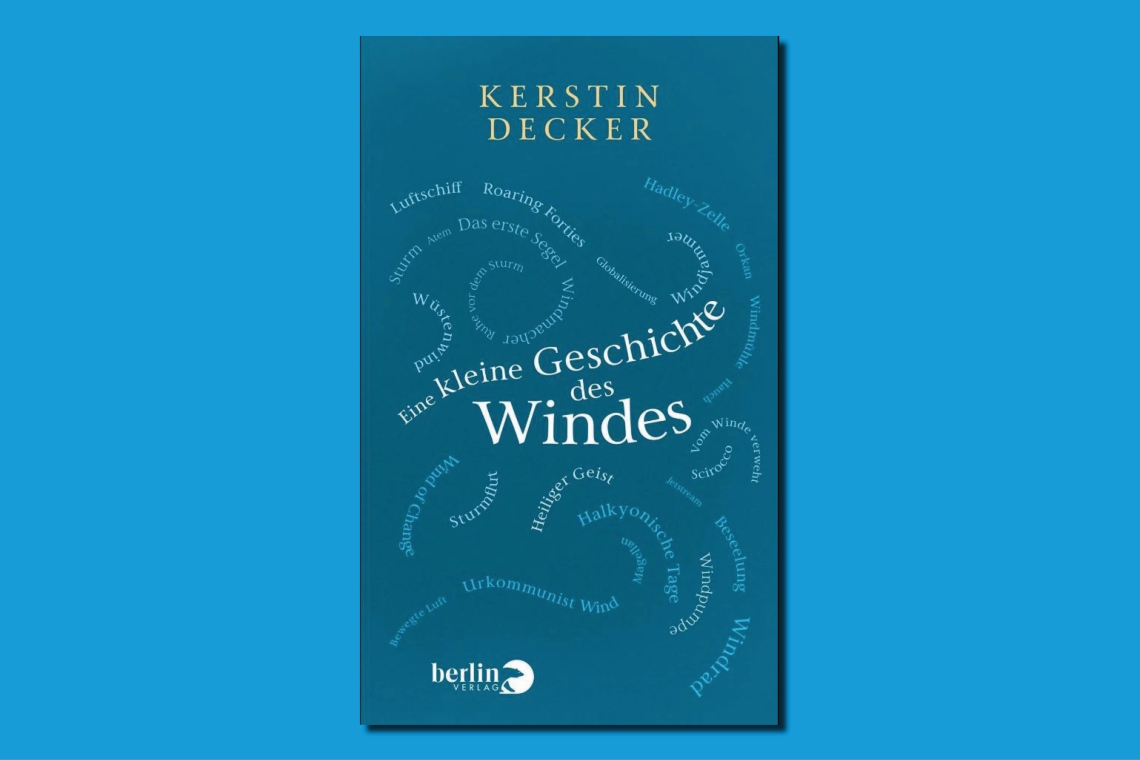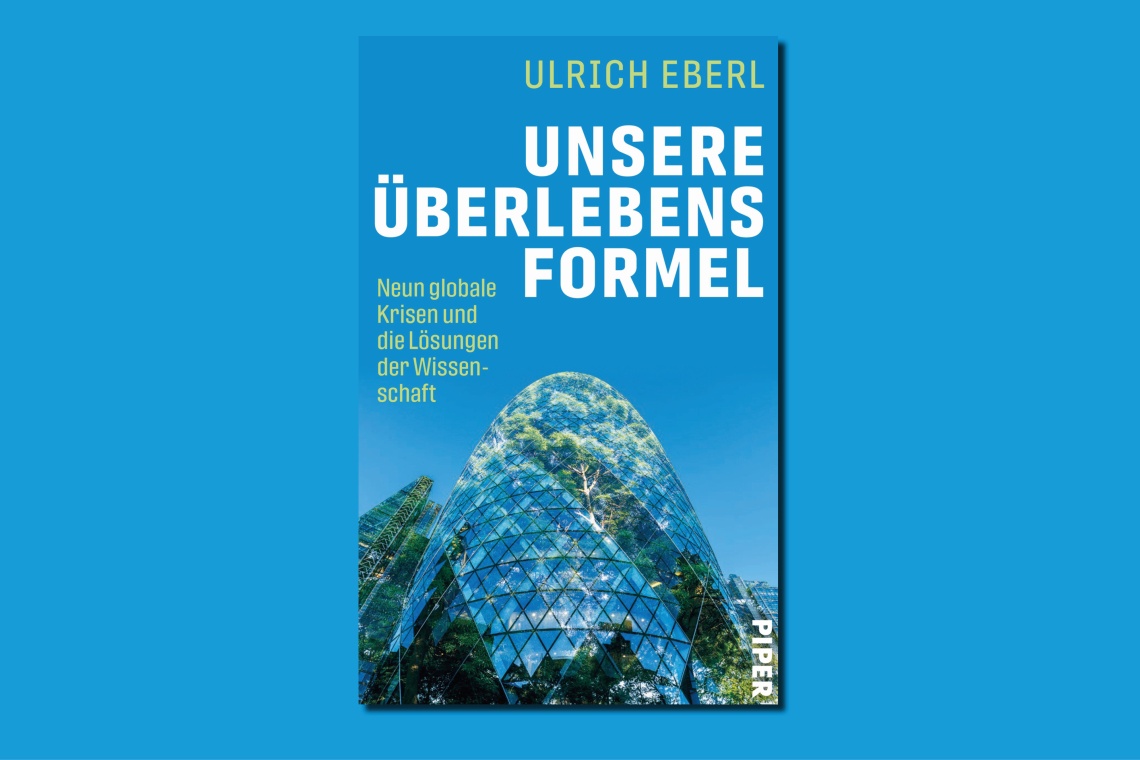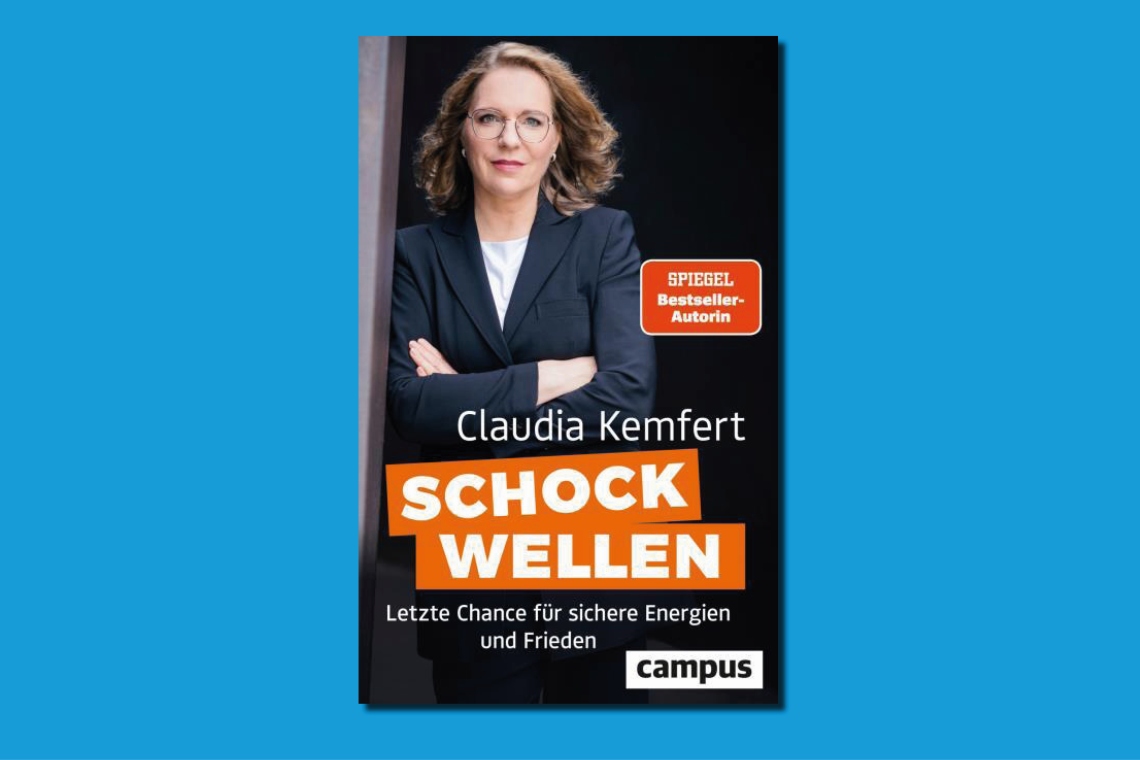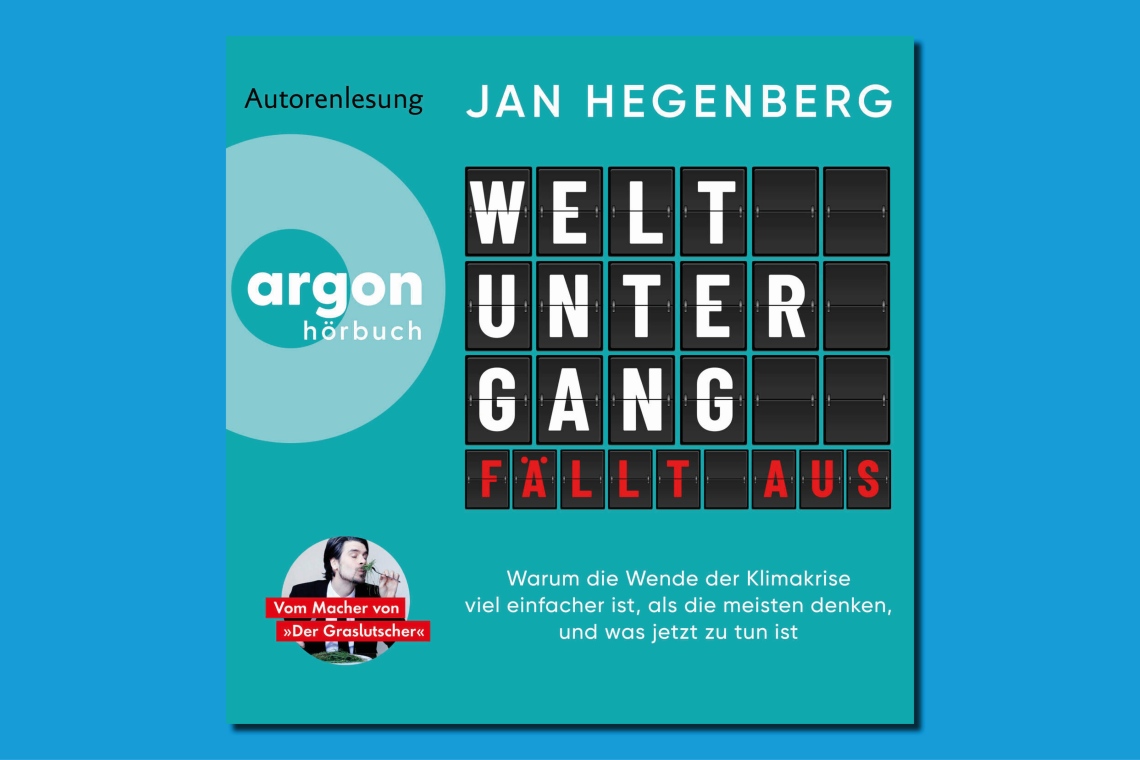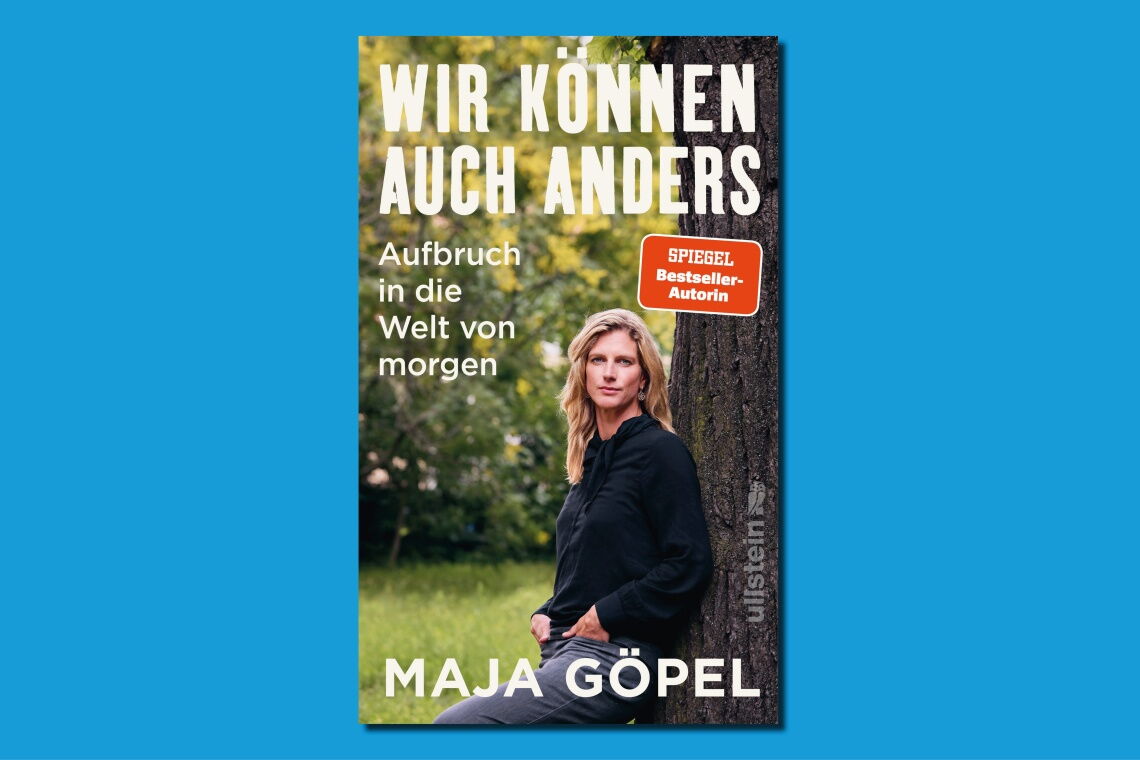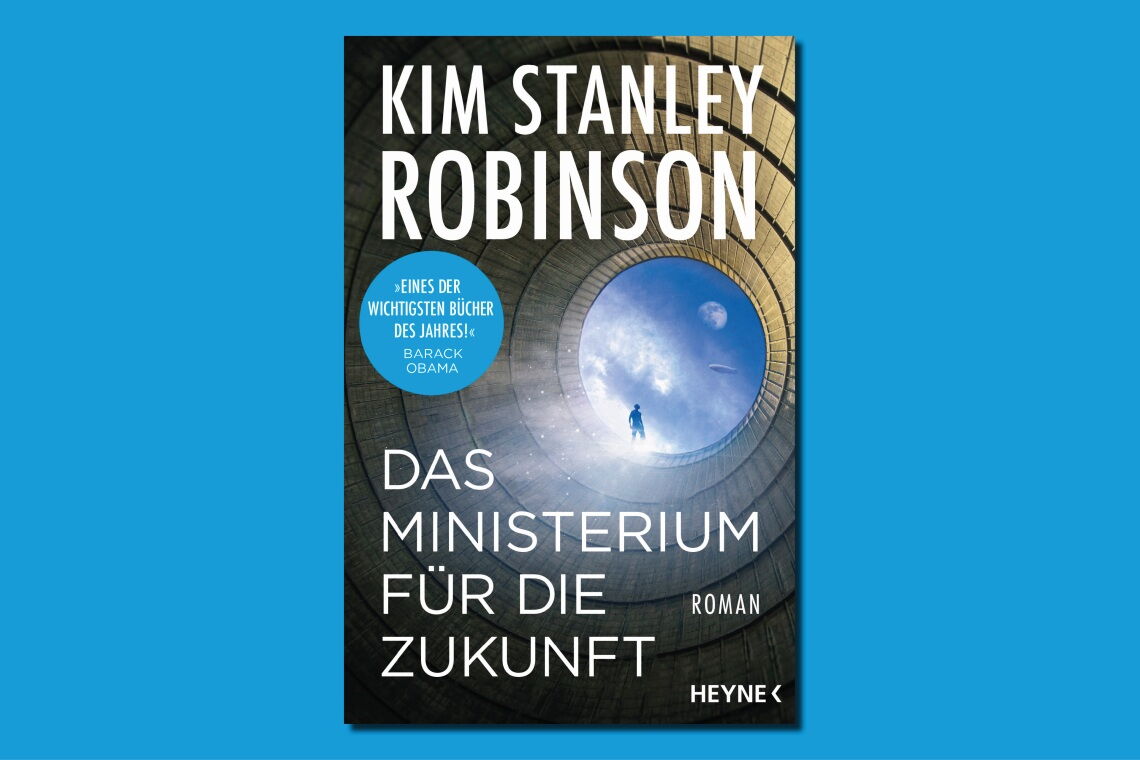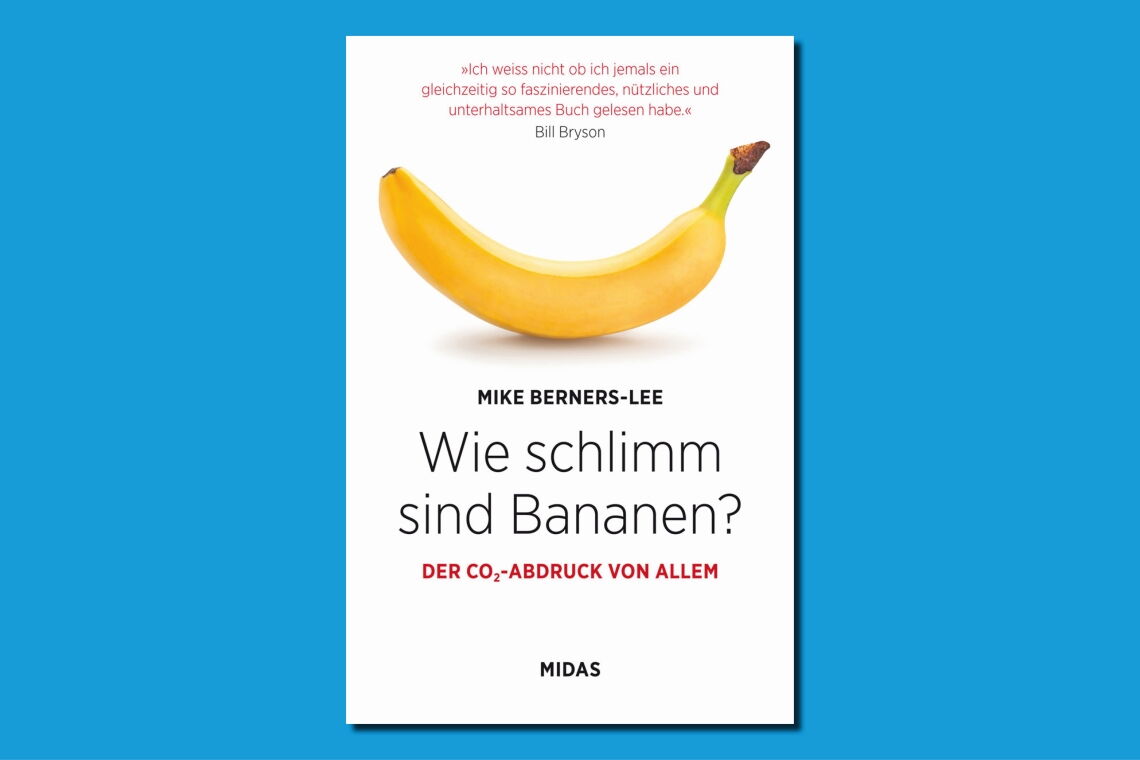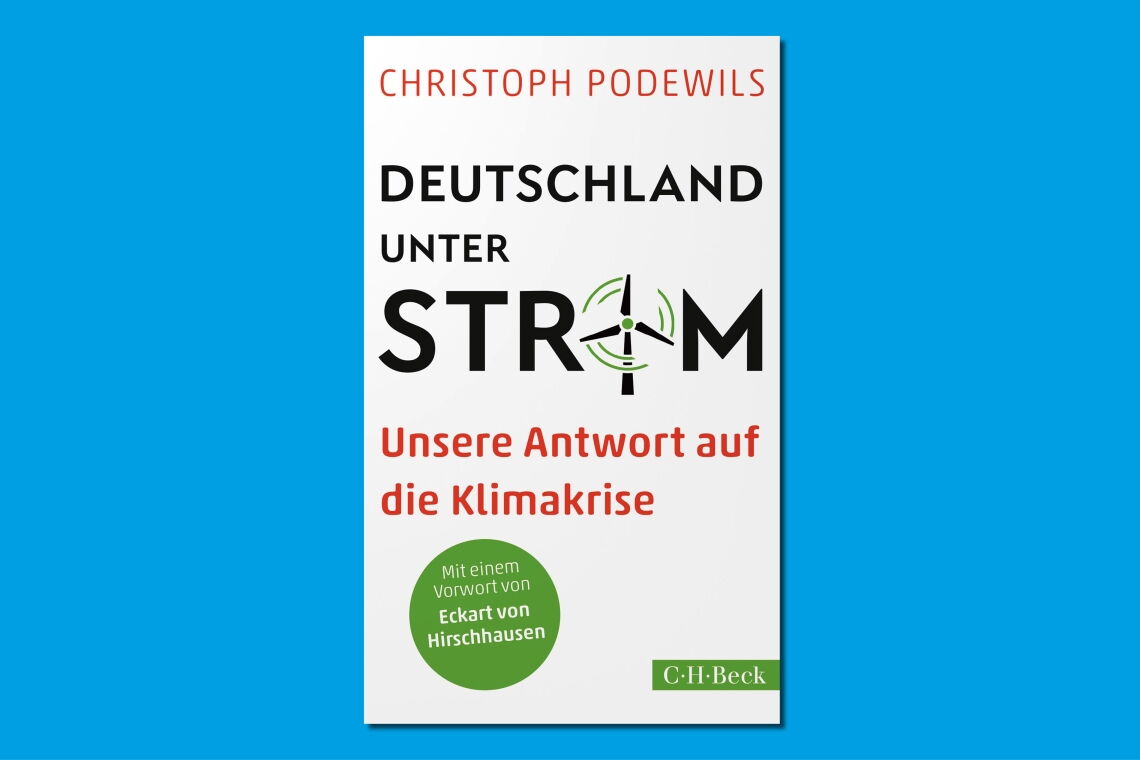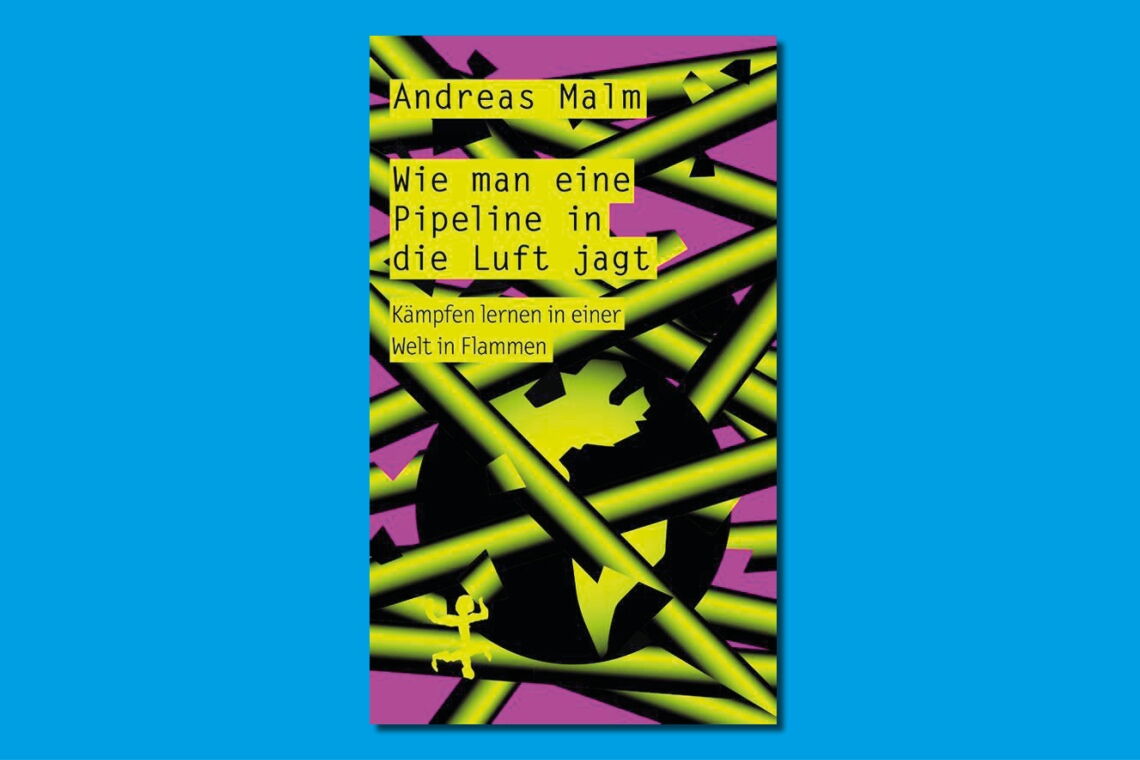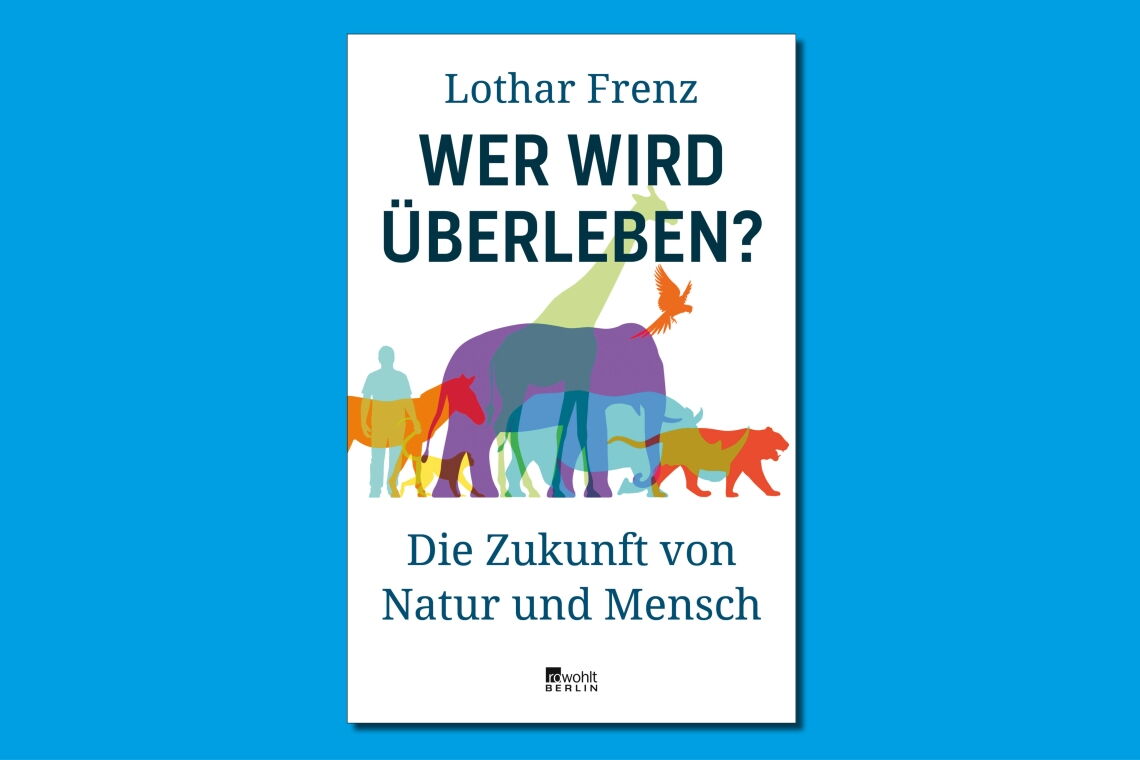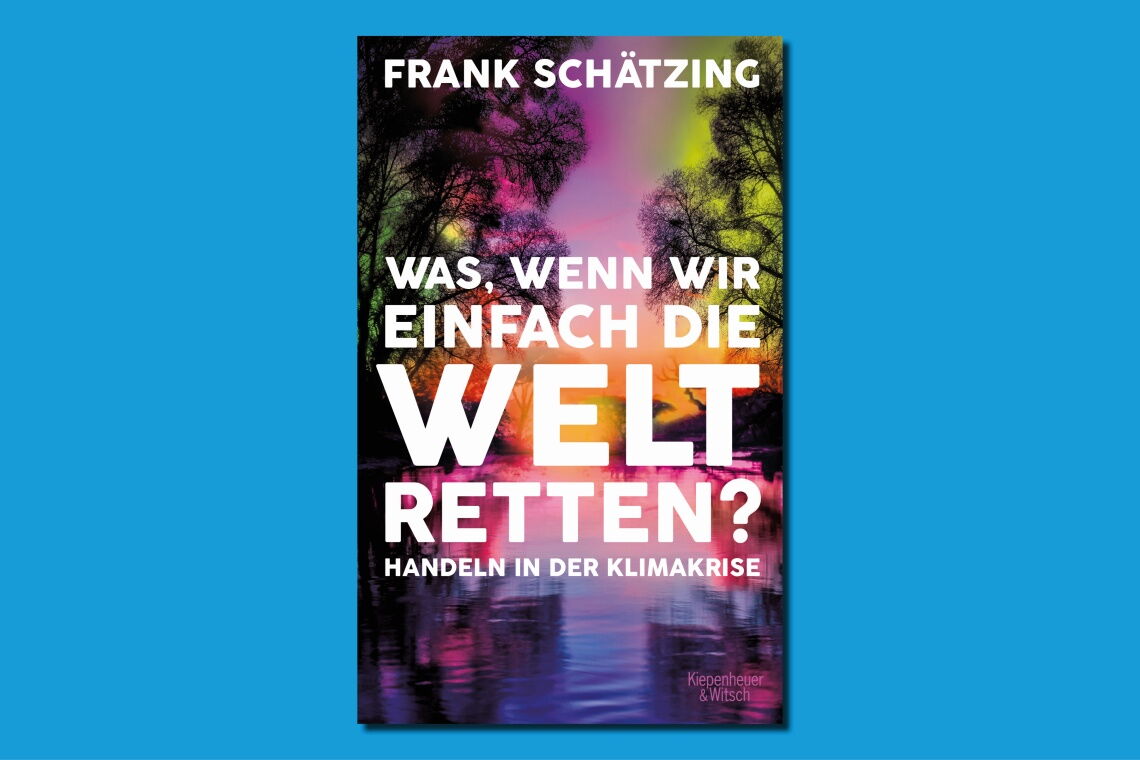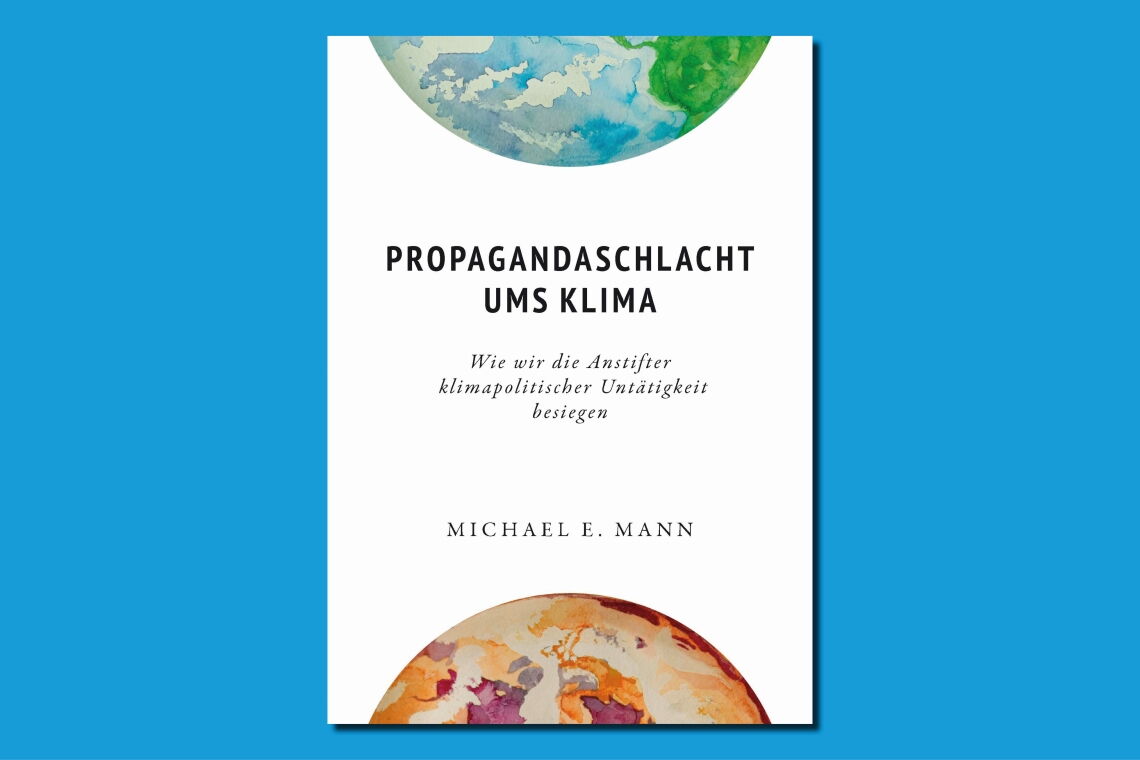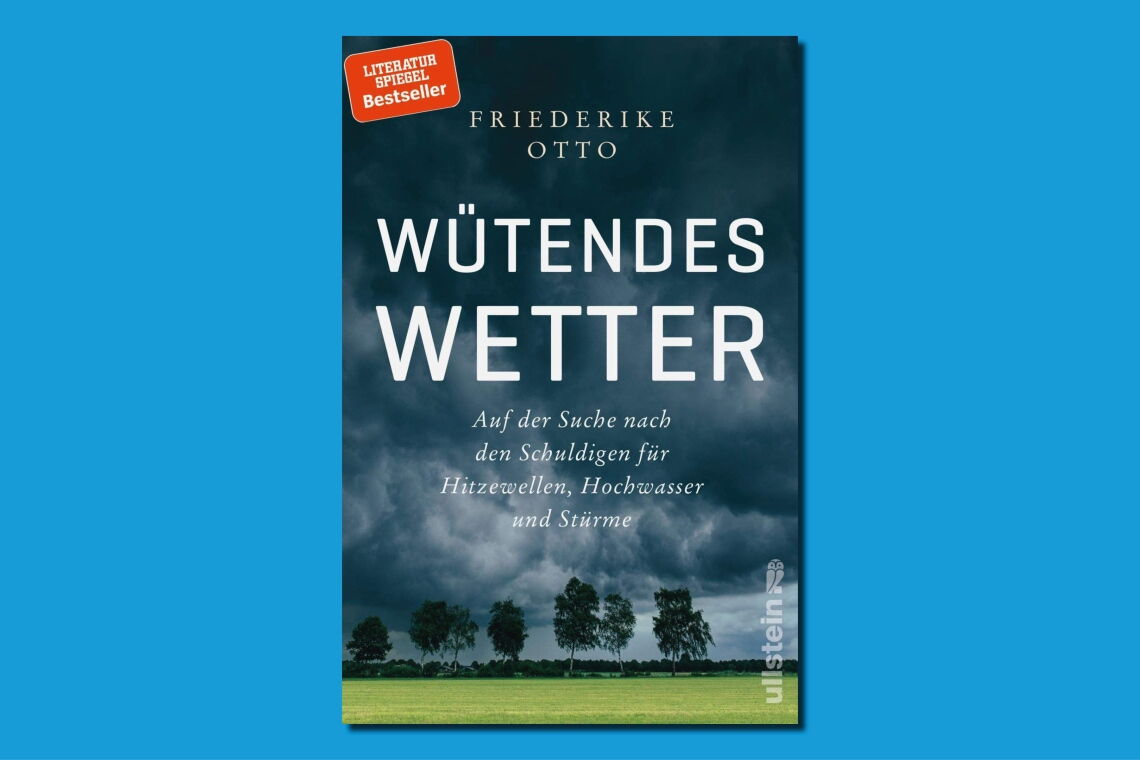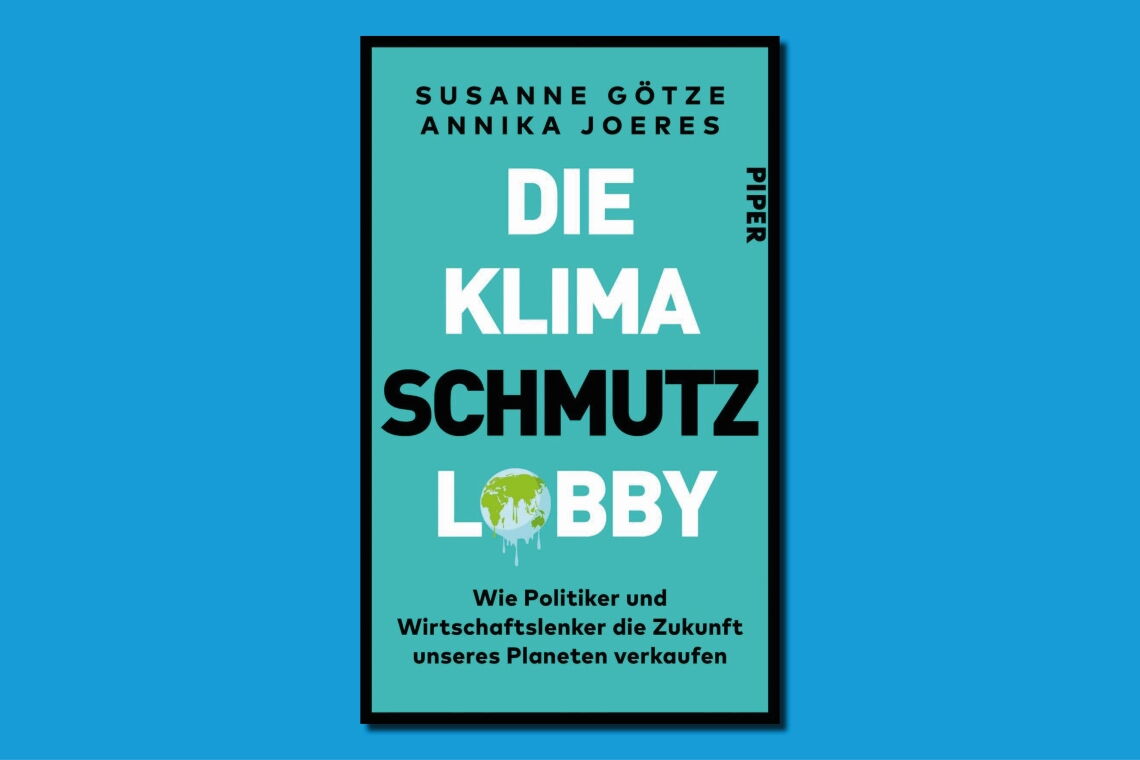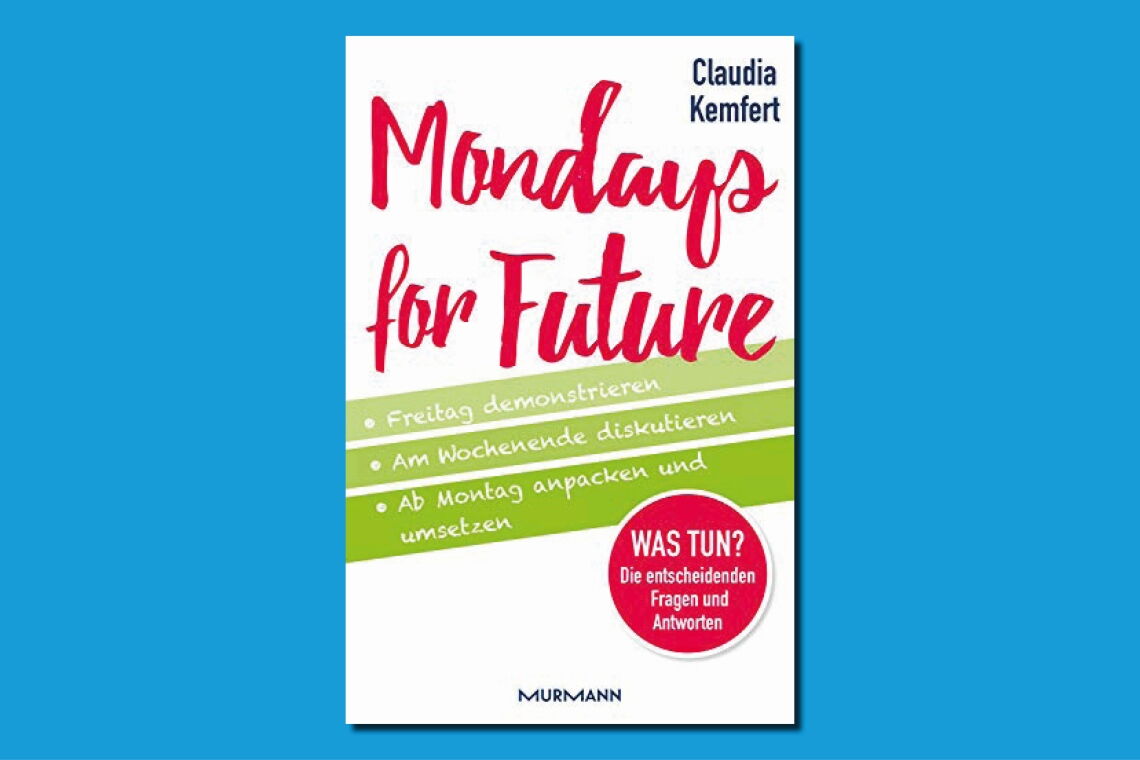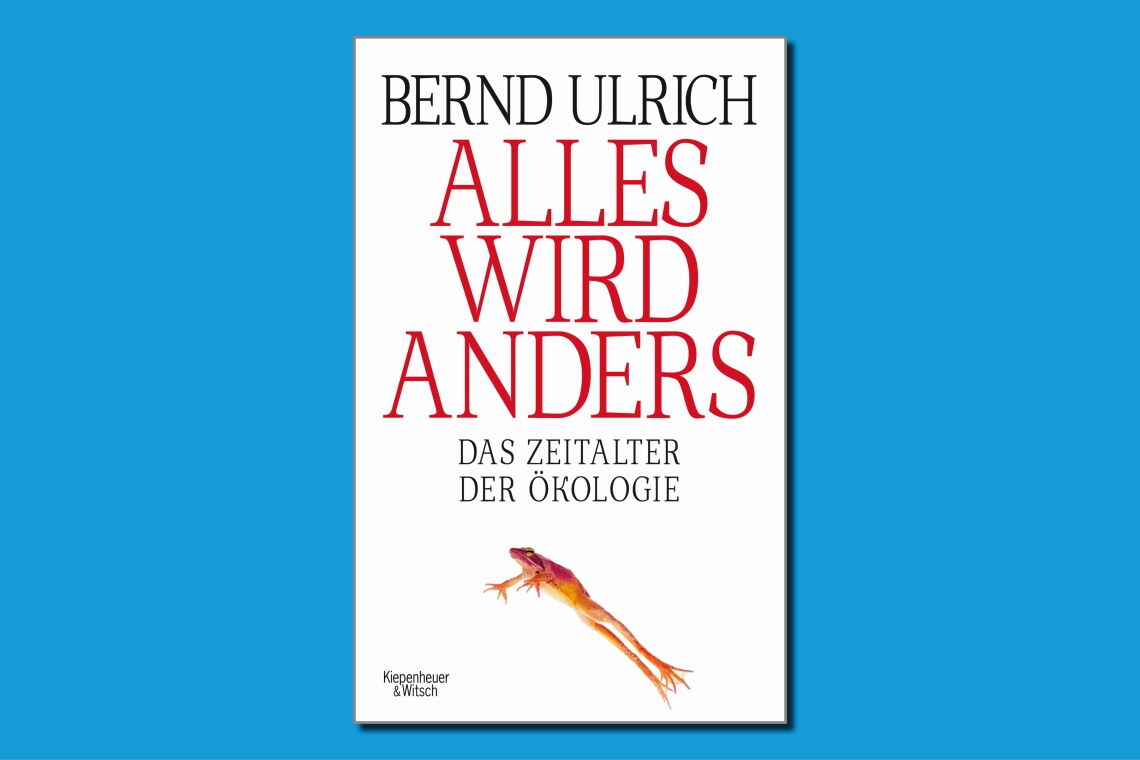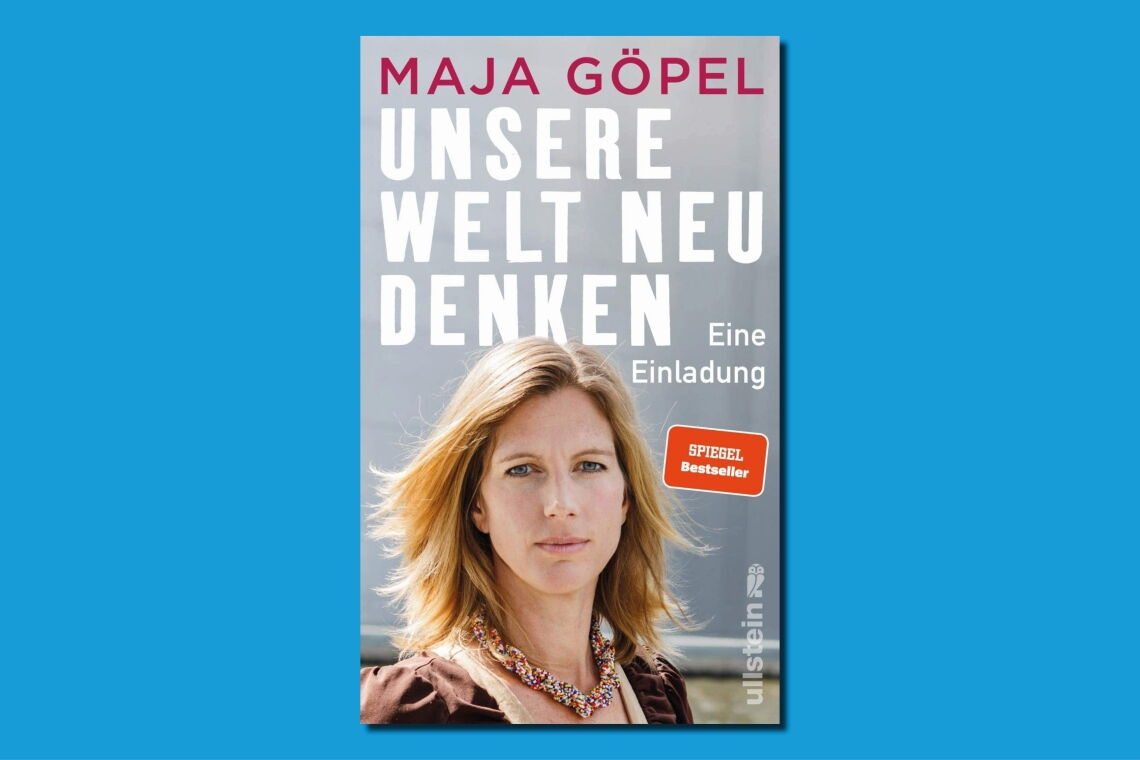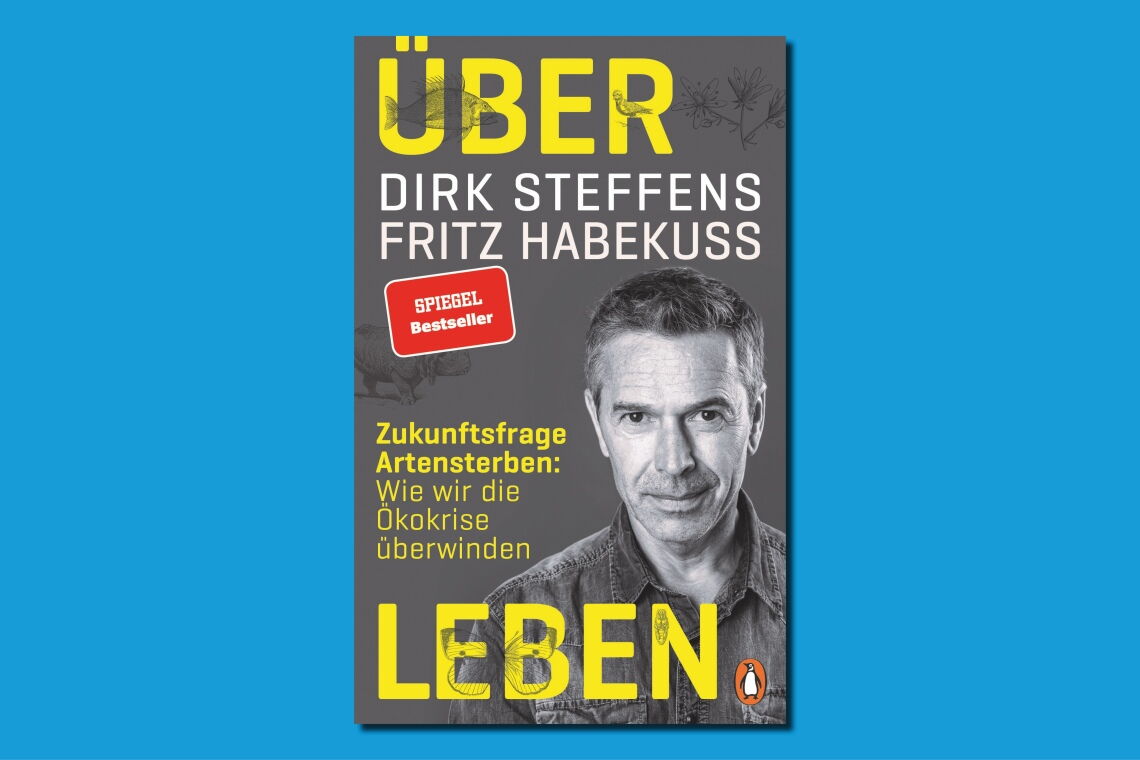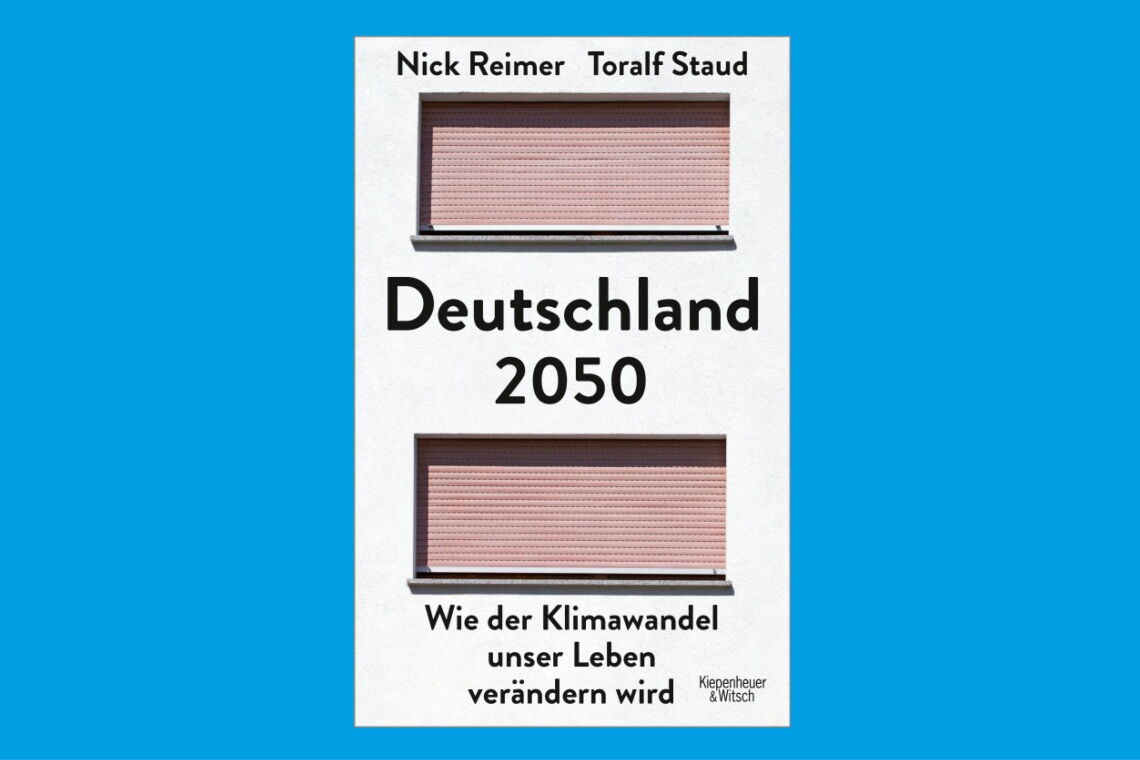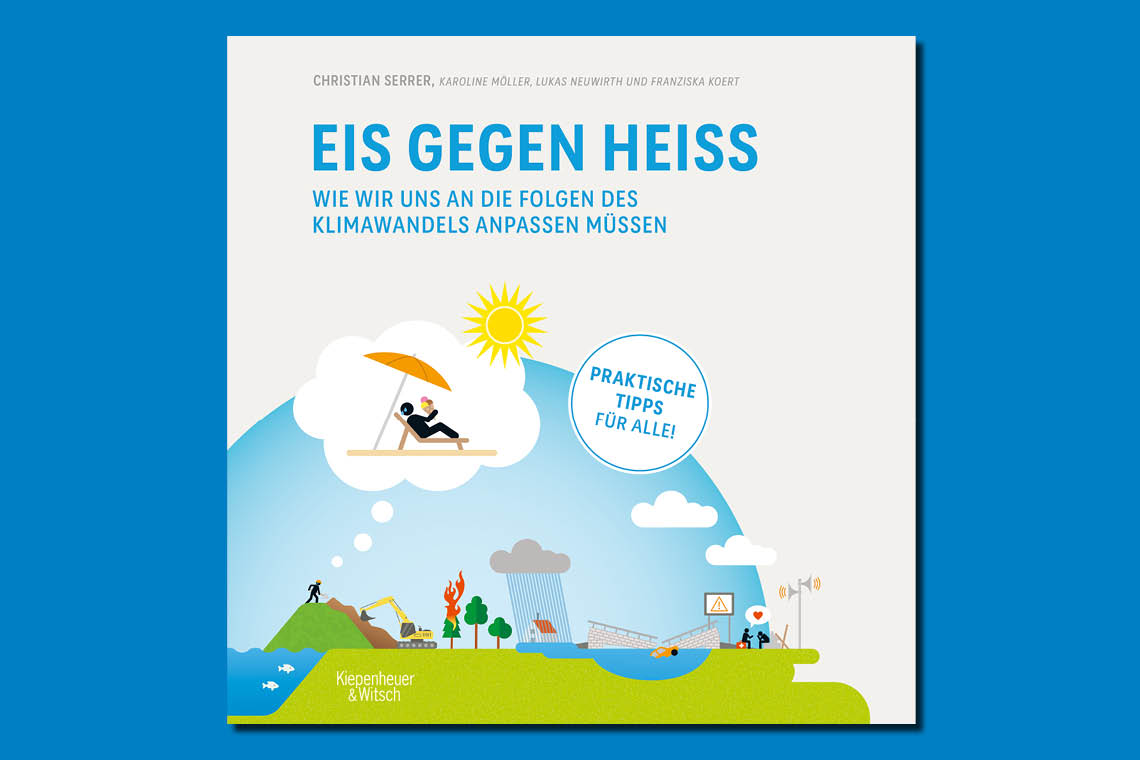
Christian Serrer: Eis gegen heiß
Der Klimawandel ist da – doch wie gehen wir mit seinen Folgen um? Diese oft ausgeblendete Frage beantworten Christian Serrer und sein Team in „Eis gegen heiß“. Das Buch liefert praktische Lösungen für den Alltag. Sich an den Klimawandel anpassen zu wollen, wird leicht als Kapitulation vor der Erderwarmung verstanden.
Doch das Buch macht klar, dass es das Gegenteil bedeutet, nämlich einen aktiven Gestaltungsprozess. Anpassung ist keine Alternative zum Klimaschutz, sondern die zwingend notwendige Ergänzung. „Wenn wir uns nur anpassen, ohne Emissionen zu senken, werden die Klimafolgen immer extremer und irgendwann technisch und finanziell nicht mehr beherrschbar“, sagt Serrer im Interview mit EnergieWinde.
Christian Serrer hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Wissenschaft allgemein verständlich aufzubereiten. 2017 merkten Serrer und sein Kommilitone David Nelles an der Zeppelin-Universität am Bodensee, dass sie zwar oft über den Klimawandel diskutierten, aber wenig über die Hintergrunde wussten. Statt ein Fachbuch zu walzen, beschlossen die beiden, selbst eins zu schreiben. Das Ergebnis – „Kleine Gase – große Wirkung“ – wurde zum Spiegel-Bestseller. Mehr als 250 Wissenschaftler unterstützten sie beim Folgeband „Machste dreckig – machste sauber“.
Mit „Eis gegen heiß“ schlagt Serrer nun ein neues Kapitel auf. Das mit zahlreichen Infografiken versehene Buch ist ein wichtiger Beitrag, weil es einen vernachlässigten Aspekt beleuchtet – die Anpassung an das, was nicht mehr zu verhindern ist. Das gelingt ihm, ohne dabei die Dringlichkeit des Klimaschutzes kleinzureden.