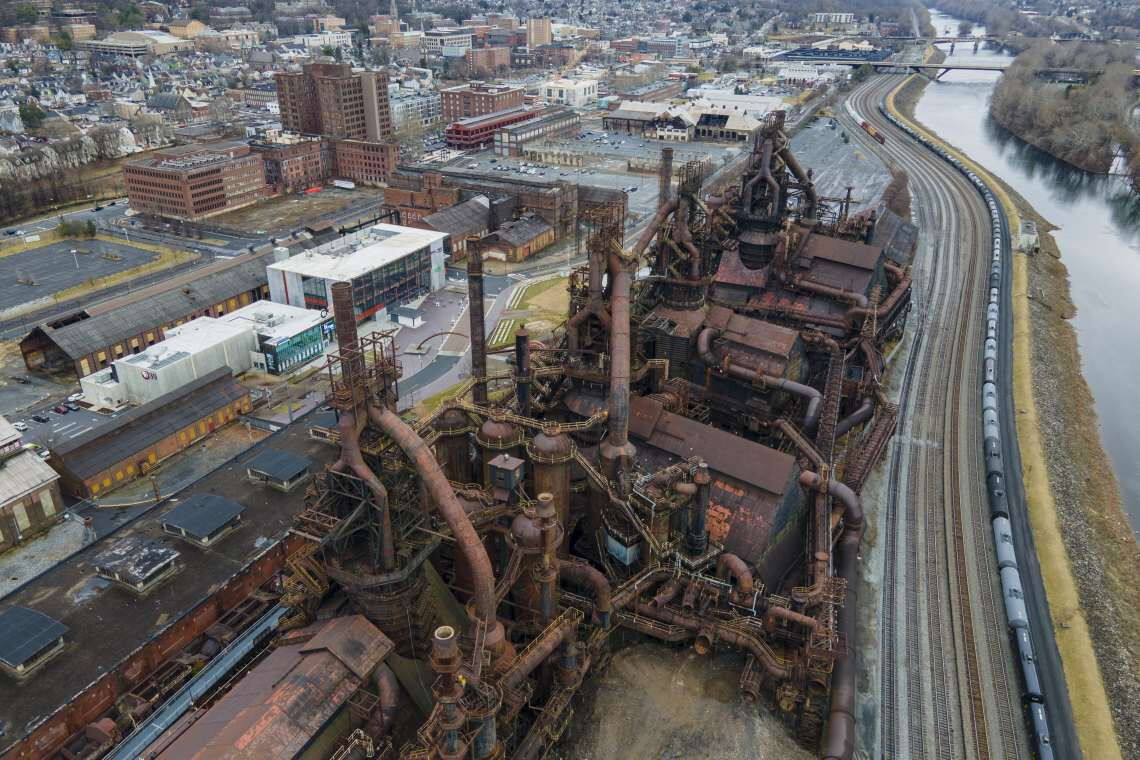Wirtschaftsvereinigung Stahl
Kerstin Maria Rippel ist Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der Interessenvereinigung von rund 50 deutschen Stahlherstellern. Mit gut 80.000 direkt Beschäftigten ist die Stahlbranche selbst vergleichsweise klein, doch ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort ist weitaus größer. Denn Stahl ist die Basis einer ganzen Reihe von Branchen, von der Bau- und Autoindustrie bis zur Windenergie. Die Stahlbranche sichert damit Schätzungen zufolge gut viereinhalb Millionen Arbeitsplätze in Deutschland. Doch die Hersteller stehen vor dem wohl größten Umbruch in ihrer Geschichte: der Umstellung auf klimafreundliche Produktionsweisen. Im Interview mit EnergieWinde beschreibt Rippel, wie Stahl grün werden soll und warum die Branche dabei Unterstützung benötigt.
Frau Rippel, Sie sprechen für eine Branche, die gut ein Drittel aller CO2-Emissionen der deutschen Industrie verursacht. Lassen sich diese kaum vorstellbaren 55 Millionen Tonnen wirklich auf null reduzieren?
Kerstin Maria Rippel: Technologisch ist das kein Problem. Wir hängen ja keinen Traumvorstellungen nach. Das Ziel ist erreichbar, und wir haben uns längst auf den Weg gemacht.
Wie weit sind Sie schon?
Rippel: Dabei muss man zwischen den beiden Routen der Stahlerzeugung unterscheiden. Elektrostahlwerke, die Schrott mithilfe von Strom einschmelzen und zu neuem Stahl verarbeiten, liefern schon heute ein relativ sauberes Produkt. Obendrein wird es mit jedem Jahr sauberer, denn je grüner der Strommix ist, desto grüner ist auch Elektrostahl. Im vergangenen Jahr hatten wir schon mehr als 50 Prozent Ökostrom im Netz, Tendenz steigend. Auf der Elektrolichtbogenroute müssen wir also die Art der Stahlerzeugung nicht wesentlich verändern, um Klimaneutralität zu erreichen, sondern vor allem dafür sorgen, dass wir genügend und bezahlbare grüne Energie haben – Strom und Wasserstoff.
Und auf der anderen Route, bei der Stahlerzeugung im Hochofen?
Rippel: ... sieht es etwas anders aus. Das ist ein sehr viel kapitalintensiverer Prozess, weil wir dabei die Produktion umstellen müssen. Im Hochofen nutzen wir bisher reinen Kohlenstoff, also Koks, um den Sauerstoff aus Eisenerz herauszulösen und Roheisen herzustellen. Dabei wird das ungeliebte CO2 frei. Statt Kohlenstoff kann den Job aber auch Wasserstoff übernehmen. Dann entsteht kein CO2, sondern H2O, also Wasser, und das ist uns allen viel lieber. Direktreduktion nennt man diesen Prozess.
... bei dem Sie allerdings noch am Anfang stehen.
Rippel: Nicht ganz. Im letzten Jahr haben vier Unternehmen in Deutschland – Salzgitter, Saarstahl, Thyssenkrupp Steel und ArcelorMittal – Förderzusagen in Höhe von rund sieben Milliarden Euro vom Staat erhalten, um den Umbau von der kohlebasierten Rohstahlerzeugung hin zur wasserstoffbasierten Direktreduktion anzustoßen. Wichtig dabei: Die Unternehmen investieren selbst noch einmal so viele Milliarden und haben damit zum Teil schon begonnen, bevor die Förderzusagen da waren!