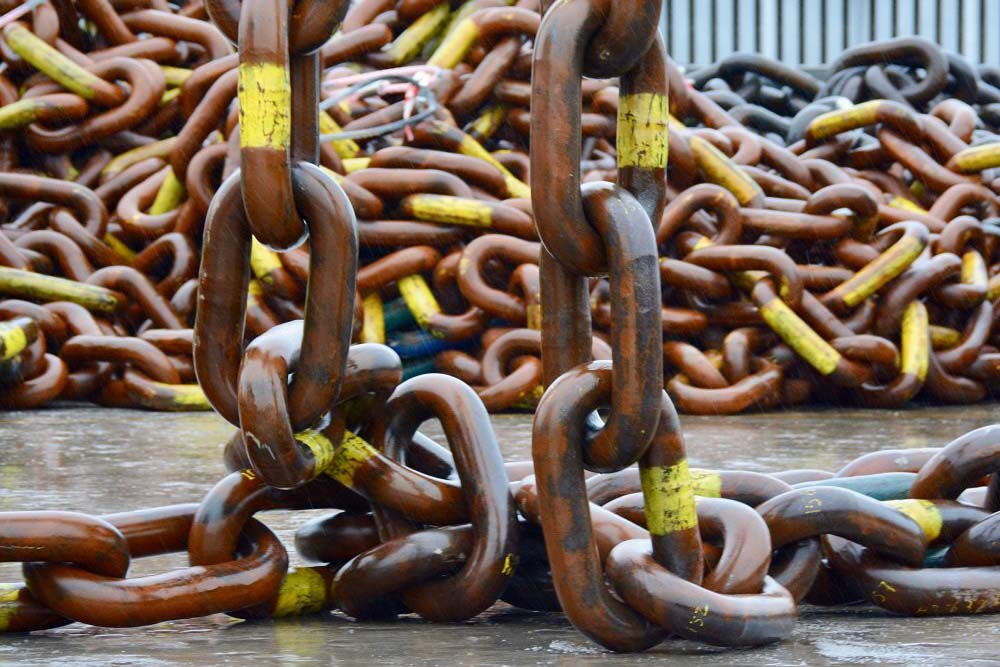Und in ein Meer, dass Tausende Meter tief ist, wird wohl auch keiner Schwimmwindräder pflanzen wollen: Auch in diesem Fall ist das Verlegen der Übertragungsleitungen und der Befestigungsleinen viel zu aufwendig.
Die Energieagentur Irena erwartet den Durchbruch zwischen 2020 und 2025
Zudem hängt die Messlatte hoch: Onshore-Strom wird schon heute für unter zehn Cent je Kilowattstunde produziert. Schwimmwindstrom dagegen kostet rund das Doppelte. Noch. Doch während das Kostensenkungspotenzial an Land praktisch ausgereizt ist, ist auf See noch reichlich Luft: Eine Studie des britischen Energy Technologies Institute prognostiziert, dass die Kilowattstunde 2020 nur noch 11,6 Cent kostet – und damit ungefähr gleichauf mit Kohlestrom wäre.
Den Preissturz in der Offshore-Windkraft demonstriert auch die Tatsache, dass Hersteller mehrerer geplanter Parks komplett auf eine feste Einspeisevergütung verzichten wollen, etwa EnBW und Ørsted.
Entsprechend macht sich die Branche bereit. Sowohl vor Schottland als auch vor Irland sollen in den nächsten Jahren weitere Schwimmwindparks entstehen. „Wir erwarten die Kommerzialisierung der Branche zwischen 2020 und 2025“, sagt Francisco Boshell.
Dass die Kosten sinken, davon gehen so ziemlich alle Fachleute aus. Auch Po Wen Cheng: „Mit der Anlagengröße spielt die Schwimmwindkraft ihre Vorteile immer mehr aus, da die Lasten vereinfacht gesagt nicht alle in den Meeresgrund abgeleitet werden müssen, sondern die Plattform durch Hydrodynamik, Ballast und Vertäuungssysteme stabilisiert wird. Das macht die schwimmenden Fundamente bei wachsender Anlagengröße und Wassertiefe gegenüber festen Fundamente immer günstiger.“
Zehn Megawatt starke Maschinen werden bereits bei fest installierten Windrädern getestet, noch größere sind in Planung. Für Andreas Schröter vom Energieberatungs- und Zertifizierungsunternehmen DNV GL sind „20 Megawatt durchaus denkbar“.
Neben dem klassischen Upscaling, also dem Größerbauen der Anlagen, könnten auch völlig neue Schwimmerkonzepte für radikale Preisstürze sorgen. Auch die sind bereits in Arbeit. So hat Windkraftikone Henrik Stiesdal vor zwei Jahren sein Projekt In-Float vorgestellt: einen radikal vereinfachten und industrialisierten Schwimmer, der die Kosten je Kilowattstunde auf sagenhafte fünf Cent drücken soll.